Kleine Anlagen, große Wirkung: Balkonkraftwerke

Ein spannendes Thema, welches wir vom InnovationLab bereits vor 1,5 Jahren beleuchtet haben. Seitdem ist allerdings viel passiert, daher greifen wir das Thema erneut auf!
Der Trend zur Eigenstromerzeugung hat in Deutschland einen neuen Meilenstein erreicht. Mit aktuell über einer Million installierter Balkonkraftwerke ist aus einem Nischenprodukt ein echter Massenmarkt geworden. Besonders spannend: Über 220.000 neue Anlagen kamen allein im ersten Halbjahr von diesem Jahr dazu.
Warum Balkonkraftwerke boomen
Haupttreiber für den Siegeszug der steckerfertigen Mini-Solaranlagen sind vor allem die gesunkenen Anschaffungskosten und gesetzliche Vereinfachungen. Seit Inkrafttreten des „Solarpakets 1“ dürfen Balkonkraftwerke vorübergehend sogar an alten Ferraris-Zählern betrieben werden – also dort, wo der Stromzähler theoretisch rückwärts laufen würde. Damit ist eine der letzten Hürden gefallen, die viele interessierte Haushalte bislang abgeschreckt hat. Wichtig: Dies gilt nur vorrübergehend!
Stromkosten senken
Ein entscheidender Faktor bleibt die Strompreisentwicklung. Laut Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft liegt der durchschnittliche Strompreis für Haushalte aktuell bei rund 39,7 Cent pro Kilowattstunde. Angesichts dessen lohnt sich jede Kilowattstunde, die nicht aus dem Netz bezogen werden muss. Eine typische Mini-PV-Anlage mit 800 Watt Leistung kann je nach Standort und Ausrichtung zwischen 600 und 900 kWh pro Jahr erzeugen. Das entspricht einer Einsparung von bis zu 350 € jährlich.
Mit einem Speicher lässt sich die Eigenverbrauchsquote zusätzlich erhöhen. Somit amortisiert sich ein Balkonkraftwerk bereits nach wenigen Jahren (natürlich kommt es hierbei darauf an, wie teuer die Anschaffung / das Balkonkraftwerk an sich war). Abgesehen davon wird das System dadurch noch effizienter. Denn ein Speicher sorgt dafür, dass nicht verbrauchter Strom zwischengespeichert und bei Bedarf, etwa am Abend oder an bewölkten Tagen, genutzt werden kann.
Technik und Installation
Ein Balkonkraftwerk besteht in der Regel aus ein oder zwei PV-Modulen, einem Wechselrichter und einer Einspeisesteckdose. Die Leistung ist gesetzlich auf 800 W begrenzt, eine Änderung von zuvor 600 W wurde Anfang 2024 beschlossen und im „Solarpaket 1“ verankert.
Wer zusätzlich einen Speicher installiert, benötigt dafür eine geeignete Anschlusslösung und sichere Integration. Je nach Modell kommen unterschiedliche Schnittstellen zum Einsatz. Fachgerechte Planung verhindert Überlastung und sorgt für ein stabiles Zusammenspiel aller Komponenten.
Was viele unterschätzen: Auch bei kleinen Anlagen ist die Sicherheit entscheidend. Fachgerecht angeschlossene Systeme sorgen dafür, dass keine Risiken durch falsche Absicherung oder unzureichende Leitungsauslegung entstehen. Elektroinstallateure sind deshalb gefragte Ansprechpartner.
Regionale Unterschiede und Potenziale
Die Verbreitung von Balkonkraftwerken variiert stark je nach Bundesland. Während in Hamburg nur knapp 8 Anlagen auf 1.000 Haushalte kommen, liegt Niedersachsen mit 34 Anlagen je 1.000 Haushalte an der Spitze. Ausschlaggebend sind vor allem die Bebauungsstruktur und in vielen Fällen schlicht das Vorhandensein eines sonnigen Balkons oder einer geeigneten Wandfläche.
Gerade in städtischen Ballungsräumen gibt es deshalb noch viel Potenzial. Insbesondere dort, wo Installateure bei Mietern, Eigentümergemeinschaften oder kleinen Betrieben für Aufklärung sorgen. Ein Balkonkraftwerk ist kein „mal eben so“-Produkt, sondern muss vernünftig (und fachgerecht) erklärt werden.
Rechtliche Rahmenbedingungen: Was erlaubt ist und was nicht
Für steckerfertige Anlagen gelten heute vereinfachte Regelungen. Der Anschluss darf durch den Nutzer selbst erfolgen, sofern eine Einspeisesteckdose vorhanden ist. Die Anmeldung beim Netzbetreiber sowie im Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur bleibt Pflicht, erfolgt aber digital und relativ unbürokratisch.
Übergangsweise ist auch der Betrieb an Ferraris-Zählern erlaubt, allerdings nur, bis diese durch digitale Messsysteme ersetzt wurden. Der Netzbetreiber ist hier in der Pflicht, für die Haushalte eurer Kunden entstehen somit keine Zusatzkosten. Während Ferraris-Zähler installiert sind, wird in solchen Fällen der Verbrauch geschätzt, bis der neue Zähler montiert ist. Spätestens bis 2032 müssen aber alle analogen Zähler gegen digitale getauscht werden!
Chancen für die Elektrobranche
Auch wenn Balkonkraftwerke oft als DIY-Lösung vermarktet werden, ist die Rolle des Elektrohandwerks nicht zu unterschätzen. Viele Kundinnen und Kunden sind verunsichert: Welcher Wechselrichter passt? Muss mein Stromkreis angepasst werden? Wo kann ich Überspannungsschutz sinnvoll integrieren? Hier punkten Profis mit Erfahrung und können gleichzeitig für größere Lösungen sensibilisieren.
Denn: Wer mit einem 800-Watt-System einsteigt, stellt häufig später auf eine größere PV-Anlage mit Speicher um. Frühzeitige Beratung sichert langfristige Kundenbindung und ermöglicht es Fachbetrieben, das Thema energetische Unabhängigkeit ganzheitlich zu begleiten.
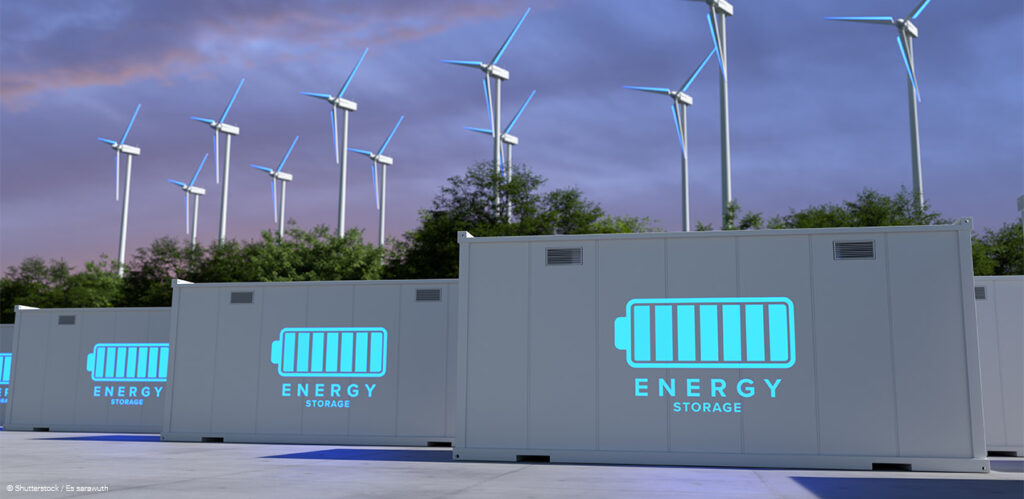





Schreiben Sie einen Kommentar